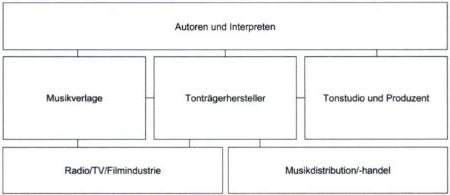|
Die wichtigsten Akteure der Musikindustrie
"Der Musikmarkt, als ein Teil des Medienmarktes, umfasst all diejenigen Akteure, die sich mit der Darstellung, Aufnahme, Produktion, Vermarktung, Verwertung und Distribution von Musik beschäftigen."1 Hierzu zählen neben den Musikschaffenden (Autoren und Interpreten) und den Tonträgerherstellern (auch als Musiklabels, Plattenlabels oder Plattenfirmen bezeichnet), der damit eng verbundene Bereich des Musikverlagswesens, Tonstudios und Produzenten, die Musikdistribution und der -handel und schließlich Radio, TV und die Filmindustrie.2
Aus Gründen der Vollständigkeit werden hier ergänzend die Verwertungsgesellschaften und das Künstlermanagement aufgeführt werden. nach oben Autoren und Interpreten stellen die Grundvoraussetzung für jegliche Musikproduktionen und die damit verbundene Auswertung dar. "Die Grundlage des Rechtsschutzes der Musikindustrie ist das Urheberrecht einschließlich den dort geregelten Urheber- und Leistungsschutzrechten."4 Nach dem Urhebergesetz (UrhG) lassen sich also generell zwei Arten von Schutzrechten unterscheiden: Urheberrechte (schützen die Autoren) und Leistungsschutzrechte (schützen die ausübenden Künstler und Tonträgerhersteller).5 "Inhaber von Urheber- und Leistungsschutzrechten sind die Hauptdarsteller im Musikgeschäft. Auf sie baut eine Wertschöpfungskette auf, die mit der Aufführung und Aufnahme der Musik beginnt und mit der privaten Vervielfältigung endet."6
nach oben Der Autor befasst sich mit der Erstellung eines Werkes, welches entweder aus einer spezifischen Tonabfolge (Melodie) oder aus dem Zusammenspiel von Text und Melodie bestehen kann und erwirbt somit als Schöpfer gemäß Â§ 2 Abs. II Nr.2 UrhG die Urheberrechte an seinem musikalischen Werk.7 So stehen jedem Urheber exklusive Nutzungsrechte, in erster Linie die in § 15 UrhG aufgezählten Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte sowie ferner das Recht der Wiedergabe auf Tonträgern gemäß Â§ 21 UrhG
und das Recht zur kommerziellen Verwertung seiner Werke zu.8 Werke im Sinne des Urhebergesetzes sind gemäß Â§ 2
Abs. II. UrhG nur persönliche geistige Schöpfungen. "Nach
herrschender Ansicht beinhalten im Musikbereich nach dem Grundsatz
der "kleinen Münze" selbst einfachste Leistungen noch die
notwendige Schöpfungshöhe, sofern mit ihnen die geringste
Individualität und Eigenständigkeit des Schöpfers zum
Ausdruck kommt (...)."9 Im Musikbereich können somit allgemein Musikkompositionen als Werke der Musik, Liedtexte als Sprachwerke, auch Musikarrangements sowie Textübersetzungen als Bearbeitungen den so genannten Werkschutz genießen.10
Urheber kann ausschließlich der Schöpfer eines Werkes, also derjenige, welcher tatsächlich ein persönliches Werk geschaffen hat, gemäß Â§ 7 UrhG sein.11 Aufgrund der Tatsache, dass diese unterschiedlichsten Rechte nur schwer von dem Urheber alleine wahrgenommen werden können, übergeben diese meist ihre Nutzungsrechte treuhänderisch an einen Musikverlag bzw. an die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), auf deren Funktionen zu einem späteren Zeitpunkt näher eingegangen wird. nach oben "Während die Entstehung eines Urheberrechts stets das Vorhandensein eines Werkes(...) voraussetzt, können Leistungsschutzrechte auch dann
begründet werden, wenn die Produktion die notwendige Schöpfungshöhe erreicht."12 Somit schützt das Urheberrecht neben dem Urheber der Musik zusätzlich den ausübenden Künstler, also primär den Interpreten eines Werkes, indem es ihm, ähnlich wie dem Urheber, Verbots- und Vergütungsrechte zuspricht. Somit darf eine Darbietung nur mit Zustimmung des Interpreten aufgezeichnet, vervielfältigt, verbreitet und gesendet werden. Sobald jedoch eine Aufnahme mit seinem Einverständnis veröffentlicht wurde, wird dieses Mitspracherecht durch einen angemessenen Vergütungsanspruch für Vermietung, Verleih und öffentliche Wiedergabe ersetzt.13 Interpreten von Musikwerken zählen im deutschen Recht zur Gruppe der ausübenden Künstler. Diese Künstler "sind nach §73 UrhG demnach Personen, die ein Werk (...) oder eine Ausdrucksform der Volkskunst aufführen, singen oder spielen (...) oder an einer solchen Darbietung künstlerisch mitwirken (...)."14 Somit kommen im Rahmen einer Musikproduktion in erster Linie die Musiker, sowohl die Hauptmusiker (z.B. Hauptinterpret und Musikband) als auch sämtliche Studiomusiker (z.B. Studiogitarristen und Backgroundsänger), als ausübende Künstler und somit als Leistungsschutzberechtigte in Betracht, soweit eine gewisse
"Interpretationsleistung" der ausübenden Künstler vorhanden ist.15 Neben den ausübenden Künstler können folglich aber
auch Tonträgerhersteller Inhaber von Leistungsschutzrechten
sein. Gemäß Â§ 86 UrhG müssen sich beispielsweise
Musiker und Label die erhaltene Vergütung teilen. Da aber weder
Label noch Interpret in der Lage sind die Öffentliche
Wiedergabe, Sendung, den Verleih oder die Vervielfältigung ihrer
Aufnahmen zu kontrollieren, übernimmt diese Arbeit die
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL), auf
deren Tätigkeitsfeld ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt
näher eingegangen wird.16
nach oben "Die Urheber (...) können mit einem Verlag einen Verlagsvertrag über die
Nutzung bestimmter Rechte an ihren Werken schließen, ferner
Mitglied der Verwertungsgesellschaft GEMA werden und von dieser
bestimmte Rechte an ihren Werken wahrnehmen lassen."17 Neben der bekanntesten deutschen Verwertungsgesellschaft der GEMA, der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, bestehen andere
Verwertungsgesellschaften, als Beispiel die GVL (Gesellschaft zur
Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH). Während sich die GEMA mit der Erstauswertung von Musik auseinandersetzt, zieht die GVL Gebühren für die Zweit- und Drittauswertung eines Künstlers ein.
nach oben Für das Verständnis der Funktion einer Verwertungsgesellschaft muss
zwischen Erst-, Zweit- und Drittverwertung, also den Auswertstufen,
die bei der Nutzung einer musikalischen Leistung in Betracht kommen,
unterschieden werden. Auf der Stufe der Erstauswertung genießt
der Künstler absolute Rechte - seine Vergütungen werden durch Individualverträge, z.B. mit dem Produzenten, geregelt. Um den Schutz auf zweiter und dritter Stufe der Verwertung zu gewährleisten, bedarf es der Verwertungsgesellschaften zur Wahrnehmung dieser Rechte18. "Erstauswertung stellt für den Künstler beispielsweise die Aufnahme seiner Leistung auf Tonträger, die Hörfunkübertragung oder Fernsehsendung einer Live-Darbietung, die Mitwirkung bei einem Film oder einer Videoproduktion dar. Zweitauswertung ist die Nutzung einer bereits fixierten oder gesendeten Darbietung, also z.B. die Sendung, öffentliche Wiedergabe und private Überspielung von Tonträgern, die öffentliche Wiedergabe und private Überspielung von Funk- und Fernsehsendungen. Drittauswertung sind u.a. die öffentliche Wiedergabe von gesendeten Tonträgern oder Filmen, die Weitersendung gesendeter Tonträger oder Filme durch Kabelunternehmen."19
nach oben Hauptaufgabe des Musikverlages ist, neben der allgemeinen Verwaltung der Rechte, die Verwertung und Förderung der Werke und die damit verbundene Schaffung einer breiten Nachfrage - sowohl im Interesse des Künstlers als auch im eigenen Interesse. Somit spielen ebenfalls die
Musikverlage neben den Tonträgerherstellern eine besondere Rolle
in der Musikindustrie. Ihr klassisches Leistungsspektrum hat sich vom
ursprünglichen Leistungsangebot, also der Distribution
musikbezogener Printmedien, im Laufe der Zeit zu Gunsten der
Verwaltung und Lizenzierung von Rechten verlagert.20 "Musikverlage verwerten die Urheberrechte an Musikwerken (mit oder ohne Text)."21
Die Zusammenarbeit mit einem Verlag kann für den Urheber eines Musikwerkes vorteilhaft sein, trotz der Abgabe eines erheblichen Anteils seiner durch die GEMA aufgebrachten Tantiemen (beispielsweise 40% im Bereich der mechanischen Vervielfältigung). Kommt es zur Auswertung, besteht die allgemeine Aufgabe des Verlages in der Übernahme der GEMA-Registrierung und der Kontrolle der GEMA-Abrechnungen. Im Bezug auf unbekannte Künstler übernimmt der Verlag oftmals die Kosten für die Produktion einer Demo-CD und leistet Unterstützung bei der Vermittlung eines Plattenvertrages mit einem Tonträgerhersteller. Bei bereits etablierten Künstlern, vor allem im Bereich der integrierten Major-Verlage, beschränkt sich die Verlags-Funktion oftmals auf die einer Bank, indem der Verlag im Hinblick auf die Werthaltigkeit der Werkkataloge der Urheber Vorschusszahlungen auf die GEMA-Tantiemen leistet.22 Vertragstechnisch sichert sich der Musikverlag zunächst in Form eines Musikverlagsvertrages die Rechte eines Komponisten und übernimmt die Abrechnung der Nutzungsgebühren für die Verwendung des Musiktitels und der Ansprüche der Zweitverwertung gegenüber den Verwertungsgesellschaften.23 Als Herzstück des Musikverlagsvertrages gilt der Katalog der auf den Verlag eingeräumten Nutzungsrechte, wobei in diesem Zusammenhang das Einräumen des ausschließlichen Verlagsrechts gem. § 8 Verlagsgesetz als unabdingbar gilt.24 Der Verlag sichert sich hierbei das exklusive Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht auf alle Ausgaben und Auflagen und im Hinblick auf aktuelle Nutzungsarten die Rechte, das Werk auf Multimedia- und anderen Datenträgern aufzunehmen, in Datenbanken und -netzten und Telefondienste einzubringen oder elektronisch und ähnlich zu übermitteln. Sodann räumt der Urheber dem Verlag die so genannten "kleinen Rechte" (weltweite Nutzungsrechte) zur gemeinsamen Einbringung bei der GEMA ein, bevor der Verlag diejenigen Nutzungsrechte erwirbt, die von der GEMA nicht wahrgenommen werden: das Bearbeitungsrecht, das Recht der Neuvertextung und -vertonung, das Recht der Verwendung für Werbezwecke, das so genannte "große Recht" (Recht zur Benutzung des Werks für Bühnenstücke), das Recht das Werk im Internet, in Datenbanken, Telefondiensten oder Multimediadiensten zugänglich zu machen sowie das Recht das Werk als Ruftonmelodie (Handyklingelton) zu nutzen.25 Da diese Nutzungen grundsätzlich eine Berührung des Urheberpersönlichkeitsrechts darstellen, bedarf es deren Ausübung die Zustimmung des Urhebers.26 Hinsichtlich der von der GEMA wahrgenommenen Rechte ist deren Verteilungsplan maßgebend für die Verteilung der Erlöse zwischen Urheber und Verlag. Sind die Verteilungspläne weder anwendbar noch zutreffend, regelt ein Schlüssel im Verlagsvertrag die Verteilung. Die Aufteilung der Erlöse aus den Rechten, die nicht von der GEMA wahrgenommen werden, basieren auf individuellen Verhandlungen.27 Zusätzlich werden heutzutage eine Vielzahl weiterer Funktionen von Verlegern übernommen, die weit über Verlagspflichten oder allgemeine vertragliche Vereinbarungen zwischen Autoren und Verlagen hinausgehen, wie beispielsweise die Übernahme der Musikproduktion oder auch das Betreiben eigener Tonstudios zum Zweck der Auswertung der verlegten Musiktitel.28 Aufgrund der Tatsache, dass das Urheber- und Vervielfältigungsrecht von absolut fundamentaler Bedeutung für die kommerzielle Verwertung von Musik ist, unterhalten mittlerweile eine Vielzahl von Tonträgerherstellern eigene Musikverlage, wie beispielsweise die großen Majors mit ihren Publishing-Häusern Universal Music Publishing, EMI Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing, Warner/Chappell Music, BMG Music Publishing.29 Somit kann auch im Bereich des Musikverlagswesens zwischen konzerngebundenen, sogenannten Major-Verlagen und Independent-Verlegern unterschieden werden. nach oben Seien es Radiostationen, Fernsehsender, Konzertveranstalter, Onlineanbieter
oder auch Cafés - jeder dieser Verwerter erhofft sich einen
geldwerten Vorteil durch den Einsatz von Musik. In diesem
Zusammenhang ist es nur selbstverständlich, dass dem Urheber
eine Beteiligung an der ertragssteigernden Wirkung seiner Musik
gewährleistet werden muss. Aus diesem Grund steht ihm überall
dort, wo diese öffentlich genutzt wird, eine gesetzlich
vorgeschriebene und angemessene Vergütung zu.30
"Um diese Vergütung einzufordern, müsste der Urheber
allen Musikverwertern persönlich die Nutzungsrechte an seiner
Musik, auch Lizenzen genannt, einräumen und zudem überprüfen,
dass auch nur die lizenzierten Titel verwendet werden. Das ist in der
realen und erst recht in der virtuellen Welt des Internets ein wohl
aussichtsloses Unterfangen."31
Aus diesem Grund übernimmt die GEMA die Mittleraufgabe zwischen Musikschaffenden und Musikverwertern. Die unten stehende Abbildung zeigt das System der Rechteübertragung und der Lizenzvergabe für die öffentliche Nutzung von Musik, die im Austausch dafür entstehende Abgabe einer Lizenzgebühr von Seiten der Verwerter und die damit verbundene Verteilung von Tantiemen an die Urheber. 
Abb.2: Das System der GEMA32 Rechteinhaber übertragen folglich der GEMA im Zuge eines Berechtigungsvertrages die Verwertungsrechte an ihren Werken, sei es auf direktem Wege oder über einen Musikverlag. Somit ist es der GEMA möglich, Lizenzgebühren von den Musikverwertern wie Rundfunk- und Fernsehsendern, Konzertveranstaltern aber auch Gastronomie-Betreibern einzufordern und eine Ausschüttung in Form von Tantiemen an die Urheber vorzunehmen.33 Die Lizenzgebühren werden nicht von Fall zu Fall, sondern nach den von der GEMA aufgestellten Tarifen bestimmt, die Ausschüttung der Tantieme erfolgt mit Hilfe eines komplexen Verteilungsplans. Zusätzlich übernimmt die GEMA die Funktion einer Kontrollinstanz und wirkt am Schutz und der Weiterentwicklung des Urheberrechts aktiv mit.34 nach oben "Um die Interessen
der Musiker in Deutschland besser vertreten zu können, wurde im
Jahre 1952 die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) gegründet,
deren wichtigstes Ziel die Verankerung des Leistungsschutzrechts für
Musiker im Urhebergesetz war."35
Nachdem erfolgreich durchgesetzt werden konnte, dass Interpreten,
Nachschaffenden und ausübenden Künstlern ähnliche
Rechte wie Urhebern zuerkannt werden, bemühte sich die Deutsche
Landesgruppe der International Federation of the Phonographic
Industry (IFPI), dass auch Hersteller von Tonträgern einen
adäquaten Leistungsschutz erhalten, folglich die Nutzungsrechte
zur Vervielfältigung und Verbreitung der von ihnen hergestellten
Tonträger und einen Vergütungsanspruch im Falle einer
Verwertung, wie der öffentlichen Wiedergabe oder Sendung ihres
Tonträgers. Aus diesem Grund wurde in Zusammenarbeit der DOV und
der IFPI im Jahre 1959 die GVL, die Gesellschaft zur Verwertung von
Leistungsschutzrechten mbH, für die Wahrnehmung der
Leistungsschutzrechte von Musikern und Tonträgerherstellern,
gegründet.36 Ihre Aufgabe besteht zum einen darin, für die öffentliche Wiedergabe, Weiterleitung in Kabelnetze und private Vervielfältigung aufgenommener und gesendeter Live-Musik sowie für Sendung,
öffentliche Wiedergabe, Weiterleitung in Kabelnetze und private
Vervielfältigung erschienener Tonträger eine Vergütung
einzuziehen. Zum anderen hat sie die von den Musikverwertern
eingenommenen Gelder nach bestimmten Verteilungsplänen an die
Leistungsschutzberechtigten, also an die Musiker und die
Tonträgerhersteller, zu verteilen. Entsprechend dem
GEMA-Berechtigungsvertrag übergeben die
Leistungsschutzberechtigten ihre Leistungsschutzrechte in einem
Wahrnehmungsvertrag der GVL.37
Das unten dargestellte System hat die identische Funktionsweise, wie das der GEMA. 
Abb.3: Das System der GVL38 "Generell werden die Vergütungen aus der Tonträgernutzung zwischen Künstlern und Herstellern 50 v.H. zu 50 v.H. aufgeteilt."39 Somit erfüllt die GVL, genau wie die GEMA eine Mittlerrolle zwischen den Rechteinhabern und den Musikverwertern.40 nach oben Der Tonträgermarkt
fungiert als wirtschaftliches Standbein der Musikindustrie und stellt
den Bereich der Herstellung, Vermarktung und Distribution von
vorbespielten Musiktonträgern über den Handel an den
Konsumenten dar.41 Doch auch das traditionelle Leistungsspektrum der Tonträgerhersteller
hat sich zunehmend erweitert und reicht mittlerweile vom Kern der
Musikaufnahme über das wachsende Produktsegment Musikvideos bis
hin zu Merchandising-Aktivitäten und Konzerten und dem Sektor
Klingeltöne und Ringback-Tones für Mobiltelefone.42
Der Tonträgerhersteller ist in Bezug auf die Musikproduktion rechtlich gesehen "derjenige, unter dessen wirtschaftlicher und organisatorischer Kontrolle die Musikaufnahme vorgenommen wird."43 Auch er kann somit Leistungsschutzrechte nach § 85 UrhG erwerben, wenn er tatsächlich die Erstfixierung der Tonfolgen auf einem Speichermedium verantwortet und somit als Hersteller des Studiomasters fungiert. Per Gesetz ist leistungsschutzberechtigt, wer "die unternehmerische Hauptleistung erbringt, also alle notwendigen Verträge im eigenen Namen schließt (mit den Musikern, dem künstlerischen Produzenten, dem Studio etc.), die organisatorische Gesamtleitung innehat und letztendlich das wirtschaftliche Risiko trägt."44 Wird die Aufnahme unter der Verantwortung eines Unternehmens durchgeführt, erwirbt der Inhaber gemäß Â§ 85 Abs. I S. 2 UrhG das Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers.45 Somit sind auch Tonträgerhersteller vom Urhebergesetz als Inhaber eigenständiger Leistungsschutzrechte anerkannt und erwerben folglich das ausschließliche Recht der Vervielfältigung und Verbreitung des von ihnen hergestellten Tonträgers. Im Bezug auf die öffentliche Wiedergabe statuiert das Urhebergesetzt zugunsten des Tonträgerherstellers ebenfalls einen gesetzlichen Vergütungsanspruch.46 Neben den eigenen Leistungsschutzrechten nach § 85 UrhG findet eine Übertragung der Rechte aller mitwirkenden Künstler an der Produktion an den Tonträgerhersteller statt. "Die Leistungsschutzrechte, die dem Künstler gemäß Â§ 73 zustehen, überträgt dieser dem Tonträgerhersteller - entweder im beschränkten Umfang oder vollumfänglich."47 In der Praxis wird aufgrund der möglichen Aufteilung der Rechte, eine Klassifizierung in Haupt- und Nebenrechte vorgenommen: "Als Hauptrechte werden die Leistungsschutzrechte der Tonträgerhersteller bezeichnet, die Musikinhalte zu vervielfältigen und zu verbreiten. Alle anderen Nutzungsrechte, etwa für Konzerte, Merchandising oder Sponsoring, werden als Nebenrechte definiert, die in der Regel beim Künstler bzw. Künstlermanagement verbleiben."48 Der Bereich der Tonträgerhersteller lässt sich in die, durch zunehmende Konzentrations- und Zentralisierungsprozesse geprägte, Seite der großen Major-Labels und die, durch Kleinunternehmen geprägte, Seite der Independent Labels, kurz Indies genannt, unterteilen. Aufgrund zahlreicher Vertriebs- und Beteiligungsabkommen zwischen den unabhängigen Unternehmen und den marktbeherrschenden Majors ist die Unabhängigkeit der Independents jedoch stark eingeschränkt.49 Die Marktmacht verschiebt sich zunehmend auf wenige große, hochintegrierte Unternehmen. Diese Entwicklung wird zusätzlich durch zahlreiche Fusionsbestrebungen, bereits seit Anfang 2006 beispielsweise zwischen der EMI Music und Warner Music im Gespräch und durch zahlreiche Aufkäufe erfolgreicher Independents durch die großen Majors begünstigt.50 nach oben Mit dem Begriff
Major-Companies werden die mittlerweile auf vier reduzierten, global
operierenden Musikunternehmen bezeichnet. Seit der Fusion von Sony
Music und BMG im Jahr 2004 sind es folglich die vier Labels Universal
Music, Sony BMG Music Entertainment, EMI Music und Warner Music, von
denen der weltweite Musikmarkt, und somit auch der deutsche Markt,
klar dominiert wird.51
Die Majors vereinigen bereits seit Jahren zusammen einen Marktanteil
von über 70 Prozent. Diese Marktdominanz unterliegt bisher
keinen maßgeblichen Änderungen, da für eine
erfolgreiche internationale Künstlervermarktung bislang nur
global operierende Unternehmen mit ihren schlagkräftigen
Vertriebsnetzen in Frage kamen. Entsprechend sehen sich die großen
Majors nicht nur als Produktentwickler, sondern ebenfalls als
Serviceorganisation zur weltweiten Durchsetzung neuer Produkte ihrer
Labelpartner. Mit Hilfe einer solchen Konstellation ist es möglich,
die Kreativität einer kleinen Firma mit der weltweiten
Durchsetzungsfähigkeit eines internationalen Unternehmens zu
verbinden.52
"Grundsätzliches Kennzeichen der Majors ist ihre vollständige
Integration."53
Zurzeit steht die EMI als letztes großes eigenständiges
Unternehmen noch alleine. Im Jahre 2004 wurde Warner Music bereits
von dem Medien-Giganten Time Warner aufgekauft54,
Sony BMG und Universal Music gehören zur Bertelsmann AG.
Entsprechend diverser Übernahmen erfolgreicher unabhängiger
Labels durch die großen Majors oder deren Gründung von so
genannten Sublabels, ist das Produktportfolio und das
Leistungsspektrum der Mächtigen im Markt sehr breit.
nach oben Neben diesen vier
Konzernen existiert eine Vielzahl kleinerer Tonträgerhersteller,
die zusammenfassend als "Independents" (kurz Indies) bezeichnet
werden.55
"Unter den "Independents" auf dem Musikmarkt versteht man in
der Regel kleine Firmen, deren Unabhängigkeit und
Selbständigkeit darin besteht, musikalisch und kulturell
eigenständige Wege zu gehen, unter Umständen auch Musik "am
Markt vorbei zu produzieren", sich vom sogenannten "Mainstream"
der Major-Companies abzuheben (...) mit dem Ziel, eine tatsächliche
Alternative anzubieten."56
Indies gelten traditionell als national oder regional ausgerichtet
und sind häufig auf bestimmte musikalische Genres spezialisiert.
Ihre Wurzeln liegen meist in den Szenen, in denen entsprechende Musik
entsteht und konsumiert wird.57
"Dieser Begriff wurde einst durch den Status der wirtschaftlichen
Unabhängigkeit jener Plattenfirmen gegenüber den
international tätigen Großunternehmen geprägt."58
Der Ausdruck "Independent" bezieht sich jedoch nicht
ausschließlich auf ein wirtschaftliches, sondern zugleich auf
ein gesellschaftliches Verhältnis (nicht die Masse) und hat
zusätzlich einen musikimmanenten Bezug (kein Mainstream). Die
dreifache Bestimmung des Begriffs erlangt eine noch höhere
Komplexität durch die Tatsache, dass die Bereiche Major und
Independent in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis
stehen. Die Major-Companies sind mächtig und beeinflussen sowohl
den Geschmack des Publikums als auch die Kreativität der
Künstler. Die Independents sind aber hoch innovativ und dienen
somit als "Kreativpool", aus dem die großen Majors schöpfen
und dessen Inhalte sie losgelöst vom ursprünglichen Bezug
in großem Umfang vermarkten.59
Neben diesen gegenseitigen Abhängigkeiten ist zudem die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Independent-Labels, aufgrund der Bindung über Vertriebs- und Beteiligungsabkommen an Majors, stark eingeschränkt und viele ehemals unabhängige Labels haben mittlerweile den Status eines "Major-Independents" (ähnliche einem Major-Unterlabel) erlangt. Selbst wenn eine solche Bindung nicht vorliegt, sind Independents vor allem im Bereich der physischen Distribution meist auf Kooperationen mit rechtlich und wirtschaftlich selbständigen Unternehmen angewiesen, um Musik auf Tonträgern flächendeckend zum Verkauf anbieten zu können.60 Das Wachstum auf dem digitalen Sektor jedoch wirkt dieser Entwicklung stark entgegen und wirkt positiv auf die Unabhängigkeit der Indies. Insbesondere die Marktnähe und spezifische Kompetenz stellen zentrale Vorteile gegenüber den Major Labels dar. Allgemein lässt sich zwischen traditionellen, adult-orientierten und so genannten "Underground-Labels" unterscheiden, die sich der "unverfälschten, authentischen" Musik widmen.61 Zu den bekanntesten deutschen Independents zählen: Four Music, Motor Music, Aggro Berlin etc. Wichtig an dieser Stelle ist zu betonen, dass der Markt als ein System der äußeren Zwänge funktioniert, das ausschließlich vom Konsum bestimmt wird.62 Folglich produziert auch die Independentkultur, deren Endverbraucher jedoch als deutlich innovativer und kreativer gilt als der Durchschnittsverbraucher, nachfrageorientiert.63 nach oben Als künstlerischer
Produzent wird derjenige bezeichnet, unter dessen Leitung die
technische Aufnahme erfolgt.64
Im Bereich der Popmusikproduktionen bestimmt er nicht nur den
späteren Sound der Aufnahme, sondern nimmt zusätzlich
erheblichen Einfluss auf das Spiel der Musiker. Im Laufe der
Produktion werden im Regelfall eine Vielzahl von Aufnahmen, so
genannte Takes, hergestellt, bis die Interpretation den Ansprüchen
des Produzenten gerecht wird. Im Bereich der Popmusik erwirbt der
Produzent somit regelmäßig einen eigenen Leistungsschutz
nach § 73 UrhG.65
Als Tonmeister im Tonstudio wird derjenige bezeichnet, "der in
Absprache mit dem Produzenten über die technischen und
akustischen Gestaltungsmittel entscheidet."66 Beschränkt sich sein Einfluss auf das Klangbild und nicht auf
die künstlerische Werkinterpretation selber, hat er rechtlich
gesehen keinen Anspruch auf einen Leistungsschutz gemäß Â§
73 UrhG. Bei Popmusikproduktionen ist es jedoch nicht unüblich,
dass beide Funktionen, die des Produzenten und die des Tonmeisters,
in einer Person verschmelzen.67
Der bei einem Tonträgerunternehmen angestellte künstlerischer
Produzent kann allenfalls Rechte als ausübender Künstler
erwerben, wohingegen bei freien künstlerischen Produzenten, die
im eigenen Namen Verträge schließen und somit das Risiko
der Produktion tragen, durchaus eine Begründung der Rechte als
Tonträgerhersteller vorliegen kann.68
Dies ist im Besonderen dann der Fall, wenn sich der Produzent, im
Rahmen eines Bandübernahmevertrages, die Rechte aus § 85
UrhG sichert.69
nach oben "Die Vertriebe bilden
die erste Handelsstufe, indem sie die Produkte bekannt machen, für
Werbung sorgen, die Promotionmaschine ins Rollen bringen und das
Produkt an den Großhandel/Einzelhandel vertreiben."70 Hierbei lassen sich wiederum die Vertriebsgesellschaften der Majors
und die Independentvertriebe unterscheiden. In der Regel arbeitet ein
Vertrieb für verschiedene Labels und deckt somit ein großes
Produktspektrum ab. Aus der Sicht des Marketings erscheint eine
Spezialisierung auf Genres sinnvoll, die sich jedoch kostenseitig
negativ auswirken kann.71 Allgemein ist der stationäre Handel durch starke Konzentrationseffekte geprägt und es können sich nur noch
wenige Angebotsformen am Markt durchsetzen. Diese Entwicklung wird
zusätzlich durch die kontinuierliche Aufgabe von Verkaufsflächen
begünstigt.72 Der Handel wird zukünftig, genau wie die Hersteller der Tonträger, mehrgleisig nach Umsätzen streben müssen.73
nach oben Der Handel wurde traditionell von Seiten des Vertriebs mittels Außendienstmitarbeitern
betreut, heutzutage nimmt jedoch aus Kostengründen die
Telefonbetreuung stetig zu. Eine spezialisierte Form des Großhandels
stellt der Systemgroßhandel bzw. Rackjobber dar, der im Auftrag
der Einzelhändler neben der Warenlieferung, eine Vielzahl
zusätzlicher Dienstleistungen zur Bewirtschaftung der
Medienfläche erbringt. Hierunter fallen u.a. die
Sortimentsbildung, die Preisauszeichnung und Warensicherung, die
Zentrallogistik und Retourenabwicklung. Diese Form des Outsourcings
ermöglicht dem Handel eine automatisierte Nachschubsteuerung und
ein schnelleres und kostengünstigeres Arbeiten, da der
Systemgroßhändler über eine umfangreiche Datenbasis
verfügt und auf den disponierten Außendienst verzichten
kann. Im Bereich des Handels lassen sich zentral operierende
Handelsketten (z.B. Karstadt oder Müller) und dezentral
organisierte Einzelhändlern unterscheiden (z.B. Media/Saturn),
die im Gegensatz zu den zentral operierenden Handelsketten ihr
Mediensortiment nach den Marktgegebenheiten vor Ort steuern, was zwar
eine hohe Kompetenz bzw. Flexibilität gewährt, jedoch
kostenseitig weniger attraktiv ist.74
nach oben Amazon.de dominiert als
reiner Internetanbieter eindeutig den Bereich des Internetversandes.
Daneben bestehen eine Vielzahl von Tonträger-Versandunternehmen,
die mit Multi-Channel-Strategien arbeiten (z.B. JPC oder Weltbild).75
"Die Entwicklung des Internets hat dem Versand von Tonträgern wichtige Impulse gegeben. So wurde es möglich, dem Konsumenten einen großen Katalog zeitnah zur Verfügung zu stellen."76 Insgesamt lässt sich eine starke Verschiebung der Umsatzanteile weg vom stationären hin zum online-basierten Handel feststellen.77 nach oben "Neben dem Vertrieb
über "Non-traditional-Outlets" setzen die Hersteller auf den
digitalen Vertrieb über das Internet. Dahinter stehen zwei
Ziele: Einmal will man dem ausufernden "Angebot" der illegalen
Tauschbörsen ein legales, kommerzielles Angebot
entgegensetzen."78
Zum anderen weist der Markt für kommerzielle Downloadangebote,
für den individuellen Konsum von Musik, eine steigende
Attraktivität für Musikanbieter und Konsumenten auf. Beim
Online-Vertrieb von Musik entfallen die Kosten für die physische
Vervielfältigung und die Distributions- und Handelskosten können
erheblich reduziert werden. Es entstehen jedoch neue Kostenarten für
die technische Auslieferung der Musikdateien, für Bezahl- und
Abrechnungsprogramme, sowie für die Unterhaltung eines
Online-Shops.79
Allgemein ist der Markt für Online Music Services durch starkes Wachstum und eine steigende Wettbewerbsintensität gekennzeichnet.80 Weltweit existiert mittlerweile eine Vielzahl kommerzieller digitaler Musikangebote, die sich in Einzeltrack- und Abonnement-basierte Services unterscheiden. Bis vor Kurzem lagen die Angebote meist in Form eines durch ein Digital Rights Management (DRM) geschützten Audioformats vor. Zum Leidwesen vieler Konsumenten führte DRM zu erheblichen Einschränkungen im Bezug auf Abspielbarkeit und Kompatibilität der Dateien mit verschiedenen Endgeräten. "So lassen sich die DRM-geschützten WMA-Dateien des Marktführers "Musicload" nicht auf Deutschlands bestverkauften digitalen Musicplayer, dem "iPod", abspielen, da Apple seine eigene Abspiel- und DRM-Software aus Wettbewerbsgründen nicht für dieses Format öffnet."81 Mittlerweile wird von DRM-Maßnahmen weitestgehend abgesehen. Technisch gesehen findet bei Online-Musikangeboten eine Unterscheidung in Streaming und Downloading statt. Beim Download werden die Daten direkt auf der Festplatte gespeichert, wohingegen beim Streaming der Datenstrom in einem Puffer lediglich zwischengespeichert und vom Decoder mit geringer Zeitversetzung ausgelesen wird. Eine Speicherung der Datei ist im Falle des Streamings also nicht möglich. Zu den wichtigsten deutschen Online Music Stores zählen neben dem Marktführer, dem iTunes Store, Musicload, Napster, Jamba, AOL, Web.de u.v.m. nach oben Im Bereich der Vermarktung stellen, neben dem an Bedeutung zunehmenden Medium Internet, vor allem die klassischen Medien Radio, TV und Film wichtige Kanäle zur Steigerung des Bekanntheitsgrades von Künstlern und deren Musikinhalte dar. Neben der absatzsteigernden Promotion-Funktion spielen die Medien als Musikverwerter zusätzlich im Bereich der Erlösgenerierung eine wesentliche Rolle für die Musikindustrie
nach oben Das Radio lebt von
Musikinhalten - sie sind es, die den Radiosendern ihre
Existenzberechtigung liefern. "Ohne Musik kann das Radio kein
großes Publikum gewinnen. Ausschließlich durch Musik ist
die Jugend an den Hörfunk zu binden. Sie lässt Akzeptanz
und Reichweiten sinken oder steigen, sie ist der maßgebliche
Sympathieträger, sie gibt in 80 Prozent der Fälle den
Ausschlag bei der Entscheidung für ein bestimmtes Programm.
Diese Tatbestände sind durch die Hörerforschung belegt."82
Gemessen an der Zeit ist das Radio das meistgenutzte Massenmedium und
erfüllt dabei optimal seine beiden Hauptaufgaben als
Begleitmedium und schnelles Informationsmedium.83
Ohne eine einschlägige Radiopräsenz ist es einem Künstler
kaum möglich, eine Akzeptanz bei einer breiten Masse zu finden.
Zusätzlich spielt die Erfassung der Airplay-Einsätze der
Musik in Hörfunkprogrammen eine wesentliche Bedeutung zur
Ermittlung der Musikcharts, die wiederum einen erheblichen Einfluss
auf die Gewohnheiten der Rezipienten haben.84
Somit besteht ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis
zwischen den Vermarktern von Musikinhalten und dem Radio als
Musikverwerter.
nach oben Das Medium TV stellt
bei der Künstlervermarktung neben der Radio- und
Werbe-/PR-Promotion ein Standbein des modernen Musikmarketing dar.
Hierbei ist ein punktuelles, aber auch strategisches Einbringen der
Künstler möglich. Derzeit lassen sich drei Formen der
TV-getriebenen Künstlerunterstützung systematisieren:
Einmal die Nutzung der Bekanntheit eines TV-Gesichts zur
Add-on-Vermarktung im musikalischen Bereich (z.B. Oli P. oder
Jeanette Biedermann aus der TV-Serie "Gute Zeiten, schlechte
Zeiten"), zweitens die TV forcierte Suche eines Musikkünstlers
durch Casting-Formate (z.B. "Popstars" oder "Deutschland sucht
den Superstar") und nicht zuletzt die strategische Kooperation
eines Musikunternehmens mit einem TV-Sender in Bezug auf die
Promotion/Vermarktung eines etablierten Künstlers oder
Newcomers, auf die hier näher eingegangen werden soll. Daneben
existieren natürlich weitere Formen der Musiknutzung im
Fernsehen, wie punktuelle Auftritte bestimmter Interpreten (z.B. bei
"Wetten dass...?") oder die Verwendung von Musik im Programm
eines Senders.85
In diesem Zusammenhang treten TV-Sender als Promotion-Mittel bzw.
Musikverwerter auf. Die strategische Kooperation zwischen
Plattenfirmen und TV-Sendern meint hingegen eine "gemeinsame
Entwicklung eines Newcomers (...), aber eben nicht sendungsimmanent,
sondern über alle sonstigen Maßnahmen, die ein TV-Sender
als Promotionoption zur Verfügung stellen und umsetzen kann."86
Sie kann auf diese Weise durchaus die erhoffte Präsenz und
Werbekraft entfalten, die zur Durchsetzung eines neuen Gesichts
notwendig ist. Im Idealfall stellt sie eine Win-Win-Situation für
beide Partner dar. Aus Sicht des Senders besteht vor allem das
Interesse an dem wirtschaftlichen Erfolg des Acts auf den
verschiedenen Auswertungsebenen zu partizipieren und den Künstler,
nach erfolgreicher Etablierung, exklusiv zu binden und somit Inhalte
und Informationen zu generieren, die der Konkurrenz verwehrt bleiben.
Für die Plattenfirma bedeutet eine solche Kooperation in erster
Linie Sicherheit, da der Sender in gewissem Maße eine breite
Öffentlichkeit für den Act garantieren kann, die ansonsten
mühsam akquiriert werden müsste.87
"Zahlreiche Goldverleihungen und die Etablierung junger Künstler
gingen - zum Vorteil der TV- und der Musikindustrie - aus diesen
Kooperationen hervor."88
Obwohl oft und oft auch zu Recht von Seiten der Kritiker die
Kurzlebigkeit und Oberflächlichkeit dieser aggressiven
Vermarktungskonzepte angeprangert wird, stellen sie ein
Musterbeispiel für die professionelle Vermarktung von Musik
dar.89
Ein Risiko für die Musikindustrie besteht darin, dass z.B. bei
Casting-Formaten wie "Deutschland sucht den Superstar", ihre
Funktionen in den Bereichen Talentsuche, Künstlerberatung und
-entwicklung von der TV-Industrie übernommen werden und sie
lediglich an den Tonträgerverkäufen partizipiert. Neben den
bisher dargestellten Formen des Musikmarketings spielen die
Musiksender VIVA und MTV, ähnlich wie das Radio, eine
wesentliche Rolle. Allgemein lässt sich erkennen, "dass das
Musikprodukt in den Märkten immer stärker mit dem Drang zum
audiovisuellen Vergnügen konfrontiert wird, daher selbst auch
immer audiovisueller (...) werden muss."90
nach oben Im Zuge der
Filmproduktion spielt die Musik eine besondere Rolle: Sie soll "die
Schwächen mancher Dialoge und Schauspieler akustisch
übertünchen, langweilige Kamerafahrten und andere "Längen"
verkürzen, gefühlvoll die Dramaturgie des gesamten Filmes
musikalisch untermalen, sich mit den Originalgeräuschen und
Effekten abstimmen (...) ein hitverdächtiges Soundtrack-Album
schaffen."91
Zudem ist die Filmmusik unabdingbar, da mit ihr erst ein emotionales
Erleben vermittelt werden kann. Zur Filmmusik gehören neben der
dramaturgischen Untermalungsmusik, ebenso die vielen Filmsongs, die
zu Welterfolgen wurden. Wer denkt bei den Abenteuern des Mr. James
Bond nicht automatisch an die vielen unvergesslichen dazugehörigen
Hits von Tom Jones, Paul McCartney, Louis Armstrong, Nancy Sinatra,
A-ha, Duran Duran, Tina Turner oder Madonna, um an dieser Stelle nur
einige zu nennen. Was wären Welterfolge wie "Pretty Woman",
"Titanic" oder "Matrix" ohne die dazugehörigen
Soundtracks?92
"Mit einem geschickt zusammengestellten Soundtrack können die
entsprechenden Zielgruppen zum Film (...) hingeführt werden.
Oder wie es ein amerikanischer Produzent formulierte: "music ist
the most important marketing tool"."93
Aber auch von Seiten der Musikindustrie spielt die Filmindustrie eine
wesentliche Rolle. Früher meist in Form der Zweitauswertung von
Nebenrechten, bei denen die Tonträgerhersteller lediglich eine
begleitende Rolle spielten, geht der Trend heutzutage mehr und mehr
in die Richtung, dass der Tonträger als substanzieller
Bestandteil der Gesamtvermarktung und die Musikindustrie als Partner
in die jeweiligen Projekte integriert werden.94
Ähnlich wie beim Crossmarketing von Musik und TV- Produktionen
ist eine erhebliche Steigerung der Erfolgschancen möglich, wenn
die Musikaufnahmen im Film als wesentlicher dramaturgischer
Bestandteil gehandhabt und nicht auf reines "Einspielen" der
Musikaufnahmen beschränkt werden. Soundtrack-Erfolge von
"Musikfilmen" wie "Comedian Harmonists", "Jenseits der
Stille", "Bandits" oder "Lola rennt" sind die besten
Beispiele für das kommerzielle Potenzial solcher Kooperationen.95
In den vergangenen Jahren waren immerhin durchschnittlich 3 Prozent
des deutschen Marktes von Soundtrack-Alben besetzt, was einem
größeren Anteil am Gesamtvolumen des Tonträgermarktes
entspricht als beispielsweise die Musikgenres Jazz, Heavy Metal,
Country oder sogar Volksmusik.96
Eine genaue Analyse des Marktes zeigt jedoch, dass deutsche
Soundtrack-Veröffentlichungen kaum an diesem relativ hohen
Marktanteil partizipieren konnten, so schafften es in den vergangenen
20 Jahren keine Hand voll deutscher Soundtrack Alben in die Charts.97
Nicht selten sehen Tonträgerfirmen den Einsatz ihres
Musikmaterials in einem Film lediglich als hervorragende
Promotion-Maßnahme und stellen aus diesem Grunde die
Einblendungsrechte unentgeltlich zur Verfügung.98
nach oben Die Position des
Managers ist in der deutschen Musikbranche nicht eindeutig
definierbar. Während in Amerika eine klare Dreiteilung in Agents
(arbeiten alleine auf dem Gebiet der Vermittlung von
Auftrittsmöglichkeiten), Personal Manager (fördern die
künstlerische Karriere durch die Vermittlung von
Plattenverträgen, das Mitarbeiten an der Image-Gestaltung sowie
der Außendarstellung, der Auswahl von Booking-Agenturen und der
Prüfung von Lizenzabrechnungen) und Business Manager (sind
alleine für finanzielle Fragen, wie Buchhaltung und Steuern,
zuständig) besteht, ist in Deutschland eine Überschneidung
dieser Bereiche in der Praxis üblich.99
"Der traditionelle "Künstlermanager" in Deutschland hat
nahezu eine "Allzuständigkeit", seine Aufgaben können
die Akquise, Verhandlung und den Abschluss von Platten- und
Verlagsverträgen, die Auswahl der künstlerischen
Produzenten, die Organisation von Konzert- und
Tourneeveranstaltungen, die Bestimmung des künstlerischen
Erscheinungsbildes des Künstlers (Image, Style, einschließlich
Auswahl des darzubietenden Materials), die Mitsprache bei der
Gestaltung von Ton- und Bildträgern, die Akquise und Verhandlung
und der Abschluss von Werbe- und Sponsoringverträgen, Die
Koordination der gesamten Presse- und Promotionaktivitäten
einschließlich sonstiger Medienkontakte (einschließlich
dem Verfassen von Pressemitteilungen und anderen Außendarstellungen),
der Administration der Registrierung bei den
Verwertungsgesellschaften (GVL, GEMA), der Überwachung von
Lizenzabrechnungen (von Tonträgerfirmen, Verlagen) und
schließlich das Inkasso der Einnahmen der Künstler
umfassen."100
Somit kann es zu Überschneidungen des Aufgabenbereichs des
Künstlermanagers mit anderen Marktteilnehmern kommen.
Vertragstechnisch werden im Rahmen eines Managementvertrags, der die
Künstler exklusiv an den jeweiligen Manager bindet, die
Aufgabenbereiche und der daraus resultierende Umfang der
Verhandlungsvollmacht festgelegt. Je nach Marktwert des Künstlers
aber auch des Managers erhält dieser zwischen 10 und 25 Prozent
und in Ausnahmefällen auch bis zu 50 Prozent Provision aus den
Künstlereinnahmen.101
nach oben
|